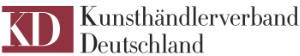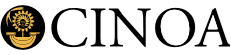Artikelnummer: 60203
Zwei Kerzenhalter,
Sterling Silber, Würzburg 1969,
MZ: Andreas Moritz
Auf geflachtem, ebenen Tellerfuß stehende Basis. Der zylinderförmige Schaft oberseitig zur Tülle hin von Profilierung abgeschlossen. Darauf die zur Reinigung entnehmbare Tülle.
Seltenes Paar zweier Kerzenhalter in 925 Silber in exzellenter Umsetzung und moderner Eleganz.
Höhe: 6,4 cm, Durchmesser (Fuß): 6,0 cm; 137,7 g und 134,2 g (nicht geschwert)
Als einer der zentralen Gestalten Deutschlands der Zeit nach 1945 ist Andreas Moritz als Silberschmied, Designer und Lehrer für das Silberschaffen der Nachkriegszeit von maßgebender Bedeutung gewesen. Seine Lehrtätigkeit an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg hat die nachfolgenden Generationen angehender Silberschmiede fundamental beeinflusst. Neben der herausragenden Fertigungsqualität seiner Silberwaren und des Tafelsilbers wohnt seinen Objekten auch ein geradezu skulpturaler Charakter inne der von einem hohen, bildhauerischen Gespür für eine ausgewogene, ponderierte und sich ruhende Form zeugt. Andreas Moritz steht zudem mit seinem Werk als Vermittler an der Schwelle zwischen den Traditionen des Bauhauses und der Moderne der Nachkriegszeit.
Bezeichnenderweise generierte sich der Kreis seiner Abnehmer zeitlebens überwiegend aus Künstlern, Intellektuellen und dem Adel. So geht beispielsweise aus seinen Aufzeichnungen hervor dass Karl Schmidt-Rottluff 1971/72 von ihm sechs Weinbecher in Sterling Silber erwarb.
Sein künstlerischer Nachlass befindet sich heute im Besitz des Germanischen Nationalmuseums, Nürnberg.
Vier Kerzenhalter ähnelnder Formgebung von Andreas Moritz befinden sich, neben anderen Objekten des Meisters, ferner im Museum of Modern Art, New York (siehe hier). Die Fülle seiner Auszeichnungen, Preise und Ausstellungen in Museen zu erwähnen, würde den Rahmen unserer Seite sprengen, es sei daher an dieser Stelle auf die Literatur verwiesen.
Der Silberschmied Andreas Moritz (Halle a. d. Saale 1901 – Würzburg 1983)
Geboren als Sohn eines Lithographen erfuhr Andreas Moritz in seiner Erziehung als Kind schon eine hohe Gewichtung in Handschreiben und Zeichnen. Mit 16 Jahren beendete Andreas Moritz seine Schulzeit und begann eine Lehre als Werkzeugmacher, bei der er die Grundlagen der manuellen Metallbearbeitung erlernte. Das darauf folgende Studium am Karlsruher Staatstechnikum brach er bald ab und begab sich für etwa zwei Jahre auf Wanderschaft. Aus Zufall wurde er bei einem Aufenthalt in Halle a. d. Saale auf die dortige Berufs- und Handwerkerschule aufmerksam. Eine Gruppe progressistischer Handwerker um Paul Thiersch war gegenwärtig dabei sich von der Lehrstätte abzuspalten und in die Burg Giebichenstein umzusiedeln um dort neue künstlerische Ansätze zu verfolgen.
Das Bauhaus sowie die Werkstatt Burg Giebichenstein gehörten zu dieser Zeit zu den ersten Lehranstalten Deutschlands, deren Lehre auf das moderne handwerkliche Schaffen ausgerichtet war. Bei den Silberwaren wie auch den Kreationen in Neusilber und Buntmetallen bedeutete dies insbesondere die Ausrichtung an das neue Bürgertum sowie dessen Forderungen an eine zeitgemäß moderne, zierbefreite Formgebung bei gleichzeitiger Wahrung der Praktikabilität. Andreas Moritz schloss sich der Lehrwerkstatt Burg Giebichenstein an, wo er für eine recht kurze Zeitspanne blieb um sich erneut auf Wanderschaft zu begeben. Künstlerische Einflüsse aus der Bildhauerei die dabei aus Begegnungen mit Bernhard Hoetger und Heinrich Vogeler resultierten, sollten zeitlebens einen Einfluss auf sein Schaffen haben. 1922 kehrte Andreas Moritz zurück nach Halle um auf Schloss Giebichenstein seine Ausbildung fortzuführen. 1924 wurde er jedoch bereits an die Kunstakademie Kassel abgeworben, an der er die Lehre von Kunst- und Werklehrern der Metallklasse übernehmen solle. Auch hier sollte Andreas Moritz nicht lange bleiben; der Wunsch nach Fortführung seiner künstlerischen Ausbildung führte ihn nach Berlin. An der von Bruno Paul geleiteten Vereinigten Staatsschule für freie und angewandte Kunst in Berlin-Charlottenburg schloss Andreas Moritz seine Studien 1932 mit dem Meisterschülerdiplom ab. Er studierte dort unter anderem Bildhauerei bei Ludwig Gies und Metallbearbeitung bei Waldemar Raemisch. 1933 wurde er unter Bruno Pauls Nachfolger Max Kutschmann wegen seiner unangepassten Haltung gegenüber dem nationalsozialistischen Regime von der Hochschule verwiesen. Obgleich Andreas Moritz sich weiterhin eine große Affinität zur Bildhauerei bewahrte, lag seine Entscheidung als Silberschmied zu arbeiten sicher auch in der Tatsache begründet dass zu dieser Zeit sich die Hauptaufträge aus Mahnmalen, Denkmälern und anderweitigen Bildhauerarbeiten für den öffentlichen Raum generierten – Arbeiten deren Umsetzung er angesichts der neuen Machthaber nicht mit sich vereinbaren konnte.
Obwohl er als Bildhauer weiterhin tätig blieb, haben sich von seinem bildhauerischen Œuvre nur wenige Büsten in Stein und Bronzearbeiten erhalten, das meiste ist lediglich durch zeitgenössische Fotografien überliefert. Nach seinem Verweis bot ihm Waldemar Raemisch die Möglichkeit die Werkstatt der Hochschule zu nutzen bis er über ein eigenes Atelier verfügte. Trotz seines Rauswurfs von der Vereinigten Staatsschule und den Kontakten zum Bauhaus (einige seiner im Bauhaus ausgestellten Arbeiten in Silber wurden bei einer Razzia beschlagnahmt) konnten die nationalsozialistischen Machthaber nicht umhin, sein hohes handwerkliches und künstlerisches Können anzuerkennen. Es wurde ihm daher die Stellung des Reichssilberschmiedes angeboten, die Moritz ausschlug. Seine weiterhin klar ablehnende Haltung gegen das Regime brachte ihn in zunehmende Schwierigkeiten, sodass er von 1934 – 1939 an der Londoner Central School of Arts & Crafts unterrichtete. Die ausgeprägte Tradition des Silberschmiedens in England sowie das Silber des 18. Jahrhunderts hinterließen bei ihm einen nachhaltigen Eindruck der sich auch in seinen späteren Teekannen und Kaffeekannen niederschlug. Der Kriegsausbruch 1939 zwang ihn England zu verlassen und er ließ sich als freischaffender Silberschmied in Berlin nieder. 1941 wurde Andreas Moritz zum Militär eingezogen, 1942 wurde seine Werkstatt von einem Bombentreffer vollkommen zerstört. 1944 erhielt er Heiratsurlaub während dem er in Hinterzarten im Schwarzwald seine Frau Berta Moritz-Siebeck heiratete. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs geriet er in Kriegsgefangenschaft aus der er 1947 entlassen wurde.
Es folgte der Umzug nach Hinterzarten wo er 1948 seine Werkstatt eröffnete. 1950 stellte er in Schwäbisch-Gmünd seine Silberwaren erstmalig aus. Die Aufmerksamkeit die er als Silberschmied mit seinen ausnehmend eleganten Silberwaren dort erregte, war es auch die dazu führte dass er 1952 an die Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg berufen wurde. Nachdem das durch die Bombardements völlig zerstörte Lehrgebäude der Nürnberger Akademie wiedererbaut war, richtete er dort eine moderne Lehrwerkstatt für Silberschmiede ein. 1968 erfolgte der private Umzug nach Würzburg wo er bis zu seinem Tod wohnhaft blieb.
Als Mensch zeitlebens nicht einfach aber immer seinen Prinzipien treu, zeigt sich in der handwerklichen Umsetzung seiner Silberwaren sein höchstes künstlerisches Formempfinden welches von der Bildhauerei beeinflusst wurde und seine keinerlei Kompromisse duldende Genauigkeit die er in jungen Jahren als Werkzeugmechaniker erworben hatte. Andreas Moritz sah seine Arbeiten nicht als bloße Ware die er herstellte um seinen Lebensunterhalt damit zu bestreiten, sondern als formgewordenes Schaffenswerk seines geistigen und kreativen Ingeniums. Sein künstlerisches Selbstbewusstsein als Silberschmied spiegelte sich auch in der Tatsache dass er seine Werke nur selten verkaufte, sondern meist von diesen Kopien herstellte die für den Verkauf gedacht waren. Von Andreas Moritz sind neben Teekannen, Trinkschalen (diese oft auf Werke der griechischen Antike rekurrierend), Bechern und Schalen auch Kirchensilber bekannt. Unter dem von ihm geschaffenen liturgischen Gerät ist insbesondere der siebenarmige Leuchter des Würzburger Domes besonders zu nennen. Auch hat Andreas Moritz Silberbestecke geschmiedet (inklusive der Messerklingen aus Stahl) die als eigenständige Besteckentwürfe der Nachkriegszeit an die bedeutenden Bestecke von Emil Lettré und Wilhelm Wagenfeld anknüpfen. Von den Schülern die von Andreas Moritz unterrichtet wurden, ist vor allem der Silberschmied Wilfried Moll der breiteren Öffentlichkeit bekannt. Wilfried Moll, geboren 1940 in Hamburg war Meisterschüler bei Moritz von 1962 bis 1965 und schloss sein Studium bei ihm mit Diplom ab. Die beiden Silberschmiede verband auch nach Molls Ausbildungszeit eine sehr enge Freundschaft, die sich auch in den Silberwaren der beiden Künstler zeigt. Den Werken beider ist die geometrische Strenge in der Formgebung, die auf Kugel, Dreieck und Quadrat fußt, gemein und teilweise ist das Werk beider Künstler derart eng miteinander verwoben, dass man nicht immer eindeutig die Urheberschaft eines Entwurfes einem der beiden Künstler zuschlagen kann – ein Detail das in der Kunstgeschichte auch in den Silberarbeiten der Wiener Werkstätte begegnet, bei denen einzelne Werke sowohl Josef Hoffmann als auch Koloman Moser zugeschrieben werden können.
VERKAUFT. ANGEBOTE ERWÜNSCHT.